Ich bin ein Leninist, ich bin kein Leninist
Bis 1926 waren wir orthodox
BERLINGUER: Das ist nicht leicht zu sagen, in einem Interview. Leninismus — das ist die gesamte Erbschaft, die uns ein großer russischer und europäischer Revolutionär hinterlassen hat. Eine Erbschaft aus 30 Jahren seines politischen und geistigen Kampfes, als Intellektueller und Parteiführer, als Journalist und marxistischer Denker, als Aktivist und Organisator, als Staatsmann und große internationale Gestalt. Man kann das alles nicht auseinanderteilen und einzeln festschreiben — weder die verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit Lenins, noch die aufeinanderfolgenden Etappen seiner theoretischen Entwicklung und seiner Praxis.
Lenin hinterließ uns eine sehr reiche und sehr komplizierte Erbschaft.
Wir fühlen uns als Fortsetzer Lenins, aber auch als seine Kritiker und Interpreten. Wir ziehen die historischen Umstände in Betracht, unter denen seine Gedanken und seine Handlungen sich Schritt für Schritt entwickelten.
BERLINGUER: Versteht man unter „Leninismus“ oder auch „Marxismus-Leninismus“ ein Handbuch der Dogmatik, eine Sammlung starrer, scholastischer Rezepte, die man kritiklos anzuwenden hat, zu jeder Zeit und an jedem Ort — dann tut man Lenin höchst unrecht, und Marx auch.
Man deformiert damit die Substanz ihrer politischen Theorie. Man mißversteht sie. Man hat die Lektion, die sie uns geben, nicht gelernt. Man muß von Marx und Lenin realisieren, was in unsrer Zeit realisiert werden kann.
Wir sind keine Leninisten im dogmatischen Sinn. Mir ist aber klar, daß es vielen Leuten gut passen würde, wenn wir solche Leninisten wären.
BERLINGUER: Die Kommunistische Partei Italiens wurde geboren auf der Schaumkrone der russischen Revolutionswelle — vor sich die große Figur Lenins. Die junge KPI war die Antwort auf jene Geistesverwirrung, auf jenes politische Vakuum, wohin die italienische Arbeiterklasse geraten war unter Führung der Sozialistischen Partei vor allem unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.
Durch die Spaltung auf dem sozialistischen Parteikongreß von Livorno (1921) entstand die KPI als ein Kern von proletarischen Kämpfern, die an die Weltrevolution glaubten und an die italienische Revolution. Wir entstanden eben auf jene Art, die historisch möglich war — und die später bekanntlich von uns selbst kritisiert wurde, durch Gramsci wie Togliatti.
In seiner Zeitschrift Ordine Nuovo schrieb Gramsci 1924: „Wir entstanden in einer Situation der Notwendigkeit. Das ist die einzige Rechtfertigung für unsre Haltung und unsre Aktivität nach der Spaltung.“ Die Notwendigkeit war jene des „physischen Kampfes zur Verteidigung gegen den faschistischen Ansturm. Das bedeutete die Konservierung der eben erst entstandenen, sehr unvollkommenen Form der Partei.“
Dieses Festhalten am Konzept des Parteigründers Amadeo Bordiga führte die Kommunistische Partei zum Abschluß gegen die Außenwelt, zu sektiererischen, schematisierenden Vorstellungen. Die Partei wurde zu einer „militärischen“ Organisation statt zu einer politischen. Es kam — wie Togliatti sagte — „zu einer Festlegung von Grenzen, welche die Partei nicht überschreiten dürfte, gemäß einer formalistischen, juristischen Anschauung der politischen Realität. Von Hegel und Marx ging man nach rückwärts zum Kantianismus.“
Das abstrakte Sektierertum der jungen KPI wurde gerade von Lenin offen kritisiert und bekämpft. Er polemisierte mehrmals heftig gegen Bordiga.
Der Bordighianismus kam Ende 1923 in die Krise. Auf dem I. Parteikongreß im Mai 1924 wurde er bereits offen angegriffen. Es bildete sich eine neue Führungsgruppe um Antonio Gramsci; auf dem III. Parteikongreß in Lyon, Jänner 1926, gewann sie die Mehrheit.
Damit setzte sich jene neue, geistige und praktische Orientierung durch, die sich bis heute gehalten und weiterentwickelt hat.
Es ist dies eine Orientierung, um wiederum Palmiro Togliatti zu zitieren, „gegen die Verwandlung der Partei in eine ausgetrocknete Sekte von realitätsfremden Talmudisten, welche die revolutionäre Bewegung der Massen einengen und abkapseln wollen“.
KPI = Marx x Macchiavelli
Das ist die Art, wie Gramsci und Togliatti die „Lektüre“ Lenins betrieben: Sie wollten in Italien eine große politische Bewegung entfachen. Sie bekam ihren ersten Antrieb von dem welthistorischen Faktum der russischen Revolution 1917. Aber sie wurde von Jahr zu Jahr reicher und genauer definiert: Trotz Ermüdungserscheinungen, Stillstand, Rückschlägen und nicht wenigen Widersprüchen gewann sie ihren eigenen geistigen und politischen Charakter.
Indem unsere Partei sich von Bordiga zu Gramsci entwickelte, rezipierte sie — aber nicht auf eklektische Weise — neben Marx, Engels, Lenin auch Macchiavelli, Vico, Cavour, Antonio Labriola. Die Entwicklung der KPI widerspiegelt die Geschichte der gesellschaftlichen Kräfte in Italien und in der Welt.
Wir sind keine Gruppe von Intellektuellen, kein Teil der herrschenden Klasse. Wir vertreten die unteren Klassen, wir sind verbunden mit der lebendigen Masse des arbeitenden Volkes. Das ist der Blickwinkel, aus dem wir die Geschichte sehen, und das ist die Methode, mit der wir unser theoretisches und praktisches Engagement Schritt für Schritt immer wieder überprüfen und korrigieren können.
Wir betreiben ein ständiges „Aggiornamento“ jener Prinzipien und Ideale, die uns von den revolutionären Klassikern überliefert wurden und durch die wir uns von den anderen Parteien als Kommunistische Partei abheben.
Wir sind eine Partei, welche die Arbeiterklasse zur Öffnung führt: zu einem weitgespannten Netz von Beziehungen und Bündnissen politischer und gesellschaftlicher Art und zur Konfrontation mit einer möglichst großen Zahl von geistigen Strömungen unserer Zeit.
Wir bewahren unsere eigene Identität als Partei, aber wir suchen die Zusammenarbeit mit anderen, von uns verschiedenen Kräften — zwecks Erfüllung unserer Aufgabe der gesellschaftlichen Transformation.
Auch Lenin hat Marx kritisch weiterentwickelt und ihm eine neue Qualität gegeben. Das gleiche machten Gramsci und Togliatti mit Lenin. Wir bemühen uns, diese Methode fortzusetzen.
Parteistatut wird geändert: Lenin raus
BERLINGUER: Dieser Teil des Statuts ist unverändert so geblieben, wie er vor vielen Jahren abgefaßt wurde. Daher ist die Formulierung unzureichend; man könnte danach meinen, daß es einen „Marxismus-Leninismus“ gibt als Kodex unbeweglicher und abgeschlossener Doktrinen. Diese Stelle über den „Marxismus-Leninismus“ muß ersetzt werden durch eine andere Formulierung, durch eine korrektere und zeitgemäßere Berufung auf die Gesamtheit des geistigen Erbes der Partei.
BERLINGUER: Der nächste Parteikongreß.
BERLINGUER: Sind Sie so sicher? Nach allem, was in Italien passiert ist und immer noch passiert, desgleichen in Europa, desgleichen in der Welt — ist da das Problem, mit dem wir italienischen Kommunisten uns befassen sollen, wirklich die Frage, ob wir Leninisten sind oder nicht?
Und alle diese Leute, die uns diese Frage stellen — wissen die überhaupt, wer Lenin war und was Leninismus ist? Wissen die überhaupt, wovon sie reden?
Gestatten Sie mir, daß ich das bezweifle.
Wie dem auch sei. Für mich ist ganz lebendig und ganz gültig die Lektion, die uns Lenin gegeben hat, betreffend eine wirklich revolutionäre Theorie:
Lenin überwand die langweilige „Orthodoxie“ des reformistischen Evolutionismus.
Lenin unterstrich das subjektive Moment, die selbständige Initiative der einzelnen Parteien.
Lenin kämpfte gegen den Positivismus, den vulgären Materialismus, desgleichen gegen den messianischen Attentismus — beides charakteristische Laster der damaligen Sozialdemokratie.
Lenin öffnete die Bresche für die Kräfte der proletarischen Erneuerung und Befreiung — in Rußland und in der Welt.
Lenin sprengte die Einheit des Kapitalismus, trieb den Keil in dessen imperialistische und kolonialistische Weltherrschaft.
Lenin kämpfte in jedem Winkel Europas gegen Krieg und für Frieden.
Lenin begriff, wie entscheidend das Bündnis zwischen Industrieproletariat und armen Bauern ist.
Und Lenin war nicht bereit, wenige Monate vor dem Oktober 1917, „selbst in einer so explosiven Situation auszuschließen, daß eine friedliche Entwicklung der sozialistischen Revolution möglich sei, unter Fortdauer des Mehrparteiensystems“ (so beschrieb dies Togliatti 1956).
Lenin verstand den Sozialismus als eine Gesellschaft, in der sich die vollendete Fülle der Demokratie verwirklichen läßt.
Um Gottes Willen Lenin
BERLINGUER: Da müssen wir differenzieren. Es ist wahr, daß sich eine Beschränkung der Meinungsfreiheit abzuzeichnen begann gegen Ende der Lebenszeit Lenins. Also noch vor dem Aufstieg Stalins. Wir zögern nicht, das zu kritisieren.
Aber darüber darf man nicht vergessen, daß es andererseits Lenin war, der in die Partei- und Staatsführung Leute hineinnahm, die vorher gegen seine politische Linie waren, sogar gegen den Aufstand im Oktober 1917 — wie Sinowjew und Kamenjew.
Was den „demokratischen Zentralismus“ betrifft, sollten wir mit den bequemen Vereinfachungen aufhören. Der spätere „bürokratische Zentralismus“ hat nichts zu tun mit dem „demokratischen Zentralismus“, wie ihn Lenin verstand und praktizierte. Das war keine präventive Vorwegnahme der Einstimmigkeit, sondern eine Methode, um am Ende einer Diskussion die nötige Einheit herzustellen in den Auffassungen und in der praktischen Arbeit der Partei. Nachdem die verschiedenen Positionen frei und demokratisch zu Wort gekommen waren, dann erst wurde die mehrheitliche Auffassung zur Position der gesamten Partei. Das ist auch richtig so.
Der demokratische Zentralismus war und ist keine Norm zur Erstickung der Meinungsfreiheit innerhalb der Partei, sondern soll — nach Erschöpfung der internen demokratischen Debatte — die elementare Voraussetzung schaffen für das wirksame, d.h. einheitliche und disziplinierte Handeln einer Partei.
Auch muß man sich vor einer weiteren Verwechslung hüten: Eines ist die Anwendung dieses demokratischen Zentralismus einer Kaderpartei, wie es die bolschewistische war — ein anderes ist die Anwendung dieses Prinzips in einer Massenpartei, wie es die unsere ist. Bei uns sind Umfang und Möglichkeiten der Demokratie viel größer.
Jeder Funktionär kann nicht nur seine Gedanken frei ausdrücken, sondern er kann auch verlangen, im Rahmen des Parteistatuts, daß ein von ihm gestellter Antrag zur Abstimmung gebracht und demokratisch darüber entschieden wird, d.h. mit Mehrheit.
BERLINGUER: Aber um Gottes Willen! Ich wollte Ihnen bloß keine manichäische oder apologetische Antwort geben aus irgendeiner vorgefaßten Parteinahme heraus.
Wir italienischen Kommunisten haben unsere Eigentümlichkeit, unsere eigene Theorie, unsere eigene Geschichte. Von der Geburt unserer Partei her, in unserer Erfahrung, in unseren Analysen, in unseren Kämpfen — da hat Lenin seinen Platz, und zwar einen sehr bedeutsamen. Aber keineswegs einen exklusiven, keineswegs einen dogmatischen.
Wer von uns verlangt, irgendwelche Verdammungsurteile zu äußern, irgendetwas abzuschwören, was Teil der Geschichte ist, und insbesondere Teil unserer Geschichte — der verlangt von uns etwas Unmögliches und etwas Schockierendes. Man kann die Geschichte nicht negieren, weder die eigene, noch die der anderen. Man soll versuchen, sie zu begreifen, zu überwinden. Man soll wachsen und sich erneuern innerhalb der geschichtlichen Kontinuität.
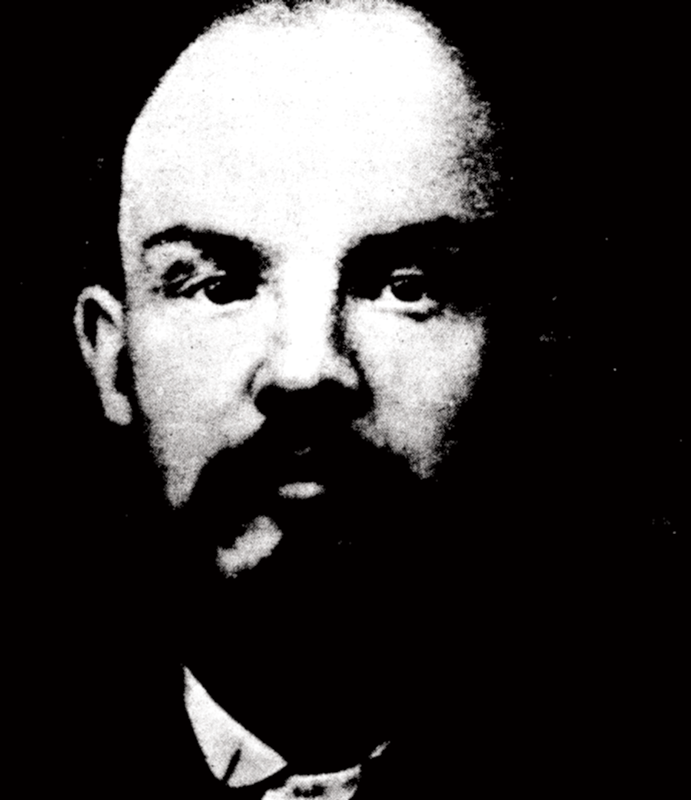
Anpassung & Pannen
Die Schritte nach vorwärts, zur Anpassung, zum „Aggiornamento“ unserer politischen Theorie und Praxis — die haben wir zustande gebracht ohne Bruch mit unserer Vergangenheit, ohne uns abzutrennen von unserem Hinterland, ohne unsere Wurzeln abzuschneiden und ohne daß hinter uns ein leerer Raum entstand.
Wir haben unser großes, unverzichtbares Erbe weiterentwickelt, jenen Schatz an Theorien und Idealen, akkumuliert in 130 Jahren seit Erscheinen des Kommunistischen Manifests. Wir haben alles daran gesetzt, uns jeder Falte der italienischen Realität anzuschmiegen, Sinn und Richtung unserer nationalen Geschichte zu verstehen und in uns aufzunehmen. In einer neuen Zeit ist unsere Partei zugleich der beste Ausdruck der kulturellen Traditionen und zivilisatorischen Leistungen Italiens.
Macchiavelli sagte: „Wenn die Republiken und Parteien sich nicht erneuern, sind sie nicht von Dauer. Und die Art, sie zu erneuern, besteht darin, sie zu ihren eigenen Prinzipien zurückzuführen.“
BERLINGUER: Ja, vor allem von 1921 bis 1924 verhielt sich die KPl so, wie Sie es darstellen. Das war fast unvermeidlich. Ich erinnere Sie jedoch daran, daß die damalige Forderung, sofort in ganz Italien Räte nach Sowjetmuster einzurichten — durch Regierungsdekret! — weder von Gramsci noch von Togliatti kam, sondern von Nicola Bombacci, den Lenin einen „Demagogen ohne Prinzipien“ nannte.
Jedenfalls, die anfängliche Linie der KPI war so, wie Sie es sagen. Das war das Ergebnis eines falschen „linken Radikalismus“ — dem übrigens fast alle kommunistischen Parteien Europas damals unterlagen. Man wollte den Leninismus in Länder exportieren und einpflanzen, wo ganz andere politische, ökonomische und soziale Verhältnisse herrschten. Man wollte die Methode der Machtergreifung mittels Aufstand vom zaristischen Rußland in den Westen übertragen — vom „tiefsten Punkt“ des kapitalistischen Systems auf seinen „höchsten Punkt“. Wir brauchten etwa 20 Jahre, um diesen Irrtum des „linken Radikalismus“ völlig und endgültig auszumerzen.
Als Togliatti 1944 in Salerno landete, sagte er mit aller Klarheit, daß wir Kommunisten in Italien nicht das Ziel haben, „es zu machen wie in Rußland“. Nicht die Sowjets, sondern das Parlament — das ist der Weg der italienischen Arbeiterklasse. Sie hat das bis ins letzte begriffen — dank der KPI.
BERLINGUER: Sie meinen vielleicht die Periode von der Gründung des Kominform (1947) und der Verurteilung Titos (1948) bis zu unserem VIII. Parteikongreß (1956). Da gab es tatsächlich eine gewisse Trübung unserer Autonomie und Originalität — einen Stillstand auf dem italienischen Weg zum Sozialismus. Vergessen wir bitte nicht, daß damals kalter Krieg war.
Aber auch in jenen Jahren hat die KPI immer das nationale Interesse verteidigt, die Demokratie, die Einheit der proletarischen Massen und der demokratischen Kräfte. Sie hat 1953 — mit den von Togliatti ausgearbeiteten Thesen — für die Rechte des Parlaments gekämpft, für die Verteidigung des Friedens gegen atomare Bedrohung, für die Begegnung zwischen Kommunisten und Katholiken.
Demokratieschule geschwänzt?
BERLINGUER: Persönlich glaube ich das.
BERLINGUER: Die Wahrheit ist: man hält die heutige KPI für gefährlich. Daher unterwirft man sie einem Kreuzverhör über ihre Vergangenheit, wirft ihr „Leninismus“ vor, damit man ihre demokratische Verläßlichkeit bezweifeln kann.
Man fürchtet, daß die neue Präsenz der KPI das bisherige Gleichgewicht der Kräfte in Gesellschaft und Staat verändert. Nun vollzieht sich nämlich der Eintritt der Arbeiterklasse in die Institutionen — bis hinauf zur höchsten Ebene.
Man hat ihr diesen Eintritt immer wieder verwehrt, mit jeder Art von legaler und illegaler Gewalt. Nun hat man Angst um alte wie neue Privilegien; sie werden durch den Eintritt der Arbeiterklasse in die Institutionen liquidiert.
Um diesen Prozeß — der schon weit fortgeschritten ist — doch noch aufzuhalten, greift man zum Exorzismus. Man will uns einer Inquisition unterziehen, betreffend unsere demokratische Rechtgläubigkeit. Und dazu gehört auch die Frage nach dem „Leninismus“. Unsere Prüfer wollen unbedingt von uns selbst hören, daß unsere Partei keine legitim italienische sei, weil sie „leninistisch“ ist.
In anderen Ländern ist die kommunistische Partei gesetzlich verboten. Hier will man, daß wir uns selbst für ungesetzlich erklären — weil wir eben „Leninisten“ sind.
Man will von uns hören: Wir Kommunisten haben uns geirrt, daß wir ins Leben getreten sind, es lebe die Sozialdemokratie, die einzige Form des politischen und sozialen Fortschritts. Dann wären unsere Examinatoren zufrieden: Die Antwort ist richtig, löst also eure Partei auf und geht schön brav nach Hause.
BERLINGUER: Viele Jahre lang hat sich vor allem die Christdemokratische Partei in dieser Rolle gefallen, zusammen mit dem reaktionären Teil der italienischen Bourgeosie und jenen internationalen Zentralen, die Italien unter ihrer Vormundschaft hielten.
Ich muß sagen: Seit einiger Zeit hat die Führungsgruppe der DC ein wenig nachgelassen in dieser Rolle, ohne sie ganz aufzugeben. Auch wichtige Gruppen der produktiven Bourgeosie sehen uns heute mit anderen Augen. Übrig bleibt noch ein starkes, wenngleich schwächer werdendes Veto von ausländischer Seite.
Dafür gibt es jetzt andere Inquisitoren, die sich berufen fühlen, uns demokratisch zu durchleuchten — nämlich die Führung der Sozialistischen Partei. Das ist neu. Und beunruhigend.
SP auf Überholspur?
BERLINGUER: Oh, ich kann das schon erklären und verstehen. Die Sozialistische Partei hat ihre eigenen Irrtümer begangen und dafür teuer bezahlt. Sie war eine große Kraft der italienischen Linken — noch 1946 die stärkste linke Partei. Dann stieg sie ab, während wir aufstiegen. Die Ursachen sind vielfältig, einige reichen viele Jahre zurück.
Der italienische Sozialismus — ich habe das schon angedeutet — produzierte keine vom Bürgertum völlig autonome Kultur und auch keine autonome Klassenstrategie. Er war immerhin eine mächtige Bewegung; er weckte als erster, vor 100 Jahren, das Bewußtsein der Proletarier und initiierte einen gewaltigen Prozeß der menschlichen und politischen Befreiung. Das ist seine Größe.
Leider fehlt der Sozialistischen Partei — trotz einzelnen sehr bemerkenswerten kulturellen und politische Beiträgen — eine genügend ausgearbeitete Theorie. Sie lebt, wie soll ich sagen, von einem ideologischen Transfer-Positivismus: Reformismus, Anarcho-Syndikatismus, Maximalismus mischen sich in ihr auf eklektische Weise.
Sie hat aber auch eine Grundeigenschaft, die sie von anderen sozialistischen Parteien des Westens unterscheidet: Sie identifizierte sich nie mit der Sozialdemokratie deutschen oder englischen Typs. Nach der Befreiung hatte die PSI einige Zeit enge Beziehungen der Einheit mit uns. Dann reklamierte sie ihre Autonomie, die ihr auch niemand streitig machen wollte. Dann, im Gefolge dieser autonomen Linie, vollzog sie ihren Eintritt in die Mitte-Links-Koalition und ihre Vereinigung mit der Sozialdemokratischen Partei. Das brachte ihr große Verluste an Anhängern und an politischer Kraft.
Diese Erfahrung führte die sozialistischen Genossen zur Korrektur ihrer Linie. Aber seit einigen Monaten versucht sich die PSI als Sammelbecken sowohl für neoliberale und neosozialdemokratische wie auch linksradikale Strömungen. Wir werden sehen, wohin das alles führt.
Aber sicher läßt uns das nicht unbeteiligt.
Die PSI ist immer noch eine große Partei der Arbeiterklasse; wenn sie stärker wird, wird die italienische Linke stärker. Bricht sie aber die Einheit der Linken, wird die Linke um soviel schwächer. Das passierte schon einmal. Wir wollen nicht, daß es wiederum passiert.
BERLINGUER: Es ist ihr Recht, sich das zu wünschen. Das beunruhigt uns nicht. Wir wollen aber, daß ein Anwachsen der PSI zusammengeht mit einem Anwachsen der Linken insgesamt, mit einer Stärkung der linken Einheit. Stattdessen scheinen einige sozialistische Genossen nur an eine Umverteilung innerhalb der Masse der linken Wählerstimmen zu denken.
Mit einer Stärkung der Linken als Ganzes scheinen sich die Genossen der PSI wenig zu befassen — obwohl das doch der wesentliche Aspekt ist.
BERLINGUER: Ich habe es schon gesagt: Dieses Fragen nach unserer demokratischen Legitimierung ist nur ein Vorwand. Ich könnte noch hinzufügen: 50 Jahre Geschichte der KPI, ihres Antifaschismus, ihrer Kämpfe für Demokratie -— das sind doch genug bestandene Examen, darüber läßt sich nicht diskutieren.
Was die europäische Sozialdemokratie betrifft, könnte ich daran erinnern, daß es auch in ihrer Geschichte dunkle Seiten gibt. Die französische Sozialdemokratie machte den Krieg in Indochina, in Algerien und die Landung am Suezkanal. Das alles in den letzten 20 Jahren. Lassen wir’s.

Die Linke kann Italien nicht regieren
Die Schwäche einer Alternative der Linken in Italien besteht darin, daß es hier eine KP gibt, die stärker ist als die SP. Daß die linke Alternative in Italien keine stabile, realistische Lösung ist, hat ganz andere Gründe.
BERLINGUER: In Italien gibt es eine katholische Frage mit absolut besonderen Zügen und eine kommunistische Frage mit ebenso besonderen Zügen. In Italien gibt es eine Bürger- und eine Arbeiterklasse, die nicht so sind wie in Westdeutschland, England oder Amerika. Ferner gibt es in Italien eine Verfassung, die anders, nämlich fortschrittlicher ist als in allen anderen kapitalistischen Ländern.
Gleichzeitig aber besteht in Italien die permanente Gefahr einer Koalition der gemäßigten, konservativen und rechtsreaktionären Kräfte mit Massenbasis.
Das sind die Gründe, warum die linke Alternative in Italien eine bloße Abstraktion bleiben muß — und nicht der angebliche Leninismus der KPI, der sie dazu bringt, die linke Alternative zu verwerfen zugunsten des breiter gefaßten historischen Kompromisses.
BERLINGUER: Keinerlei Wasser. Der historische Kompromiß wurde absichtsvoll verwechselt mit etwas, was er nie war. Man hat gesagt: die KPI will sich mit der DC verständigen und alle anderen politischen Kräfte draußen lassen. Wir haben niemals an eine solche Dummheit gedacht. Man hat sich ein Ziel gebastelt, auf das man leicht schießen kann.
BERLINGUER: Bitte. Italien ist ein Land, das große Veränderungen braucht, soziale, ökonomische, politische — eine tiefgreifende Erneuerung der Strukturen, der öffentlichen Moral und der gesellschaftlichen Organisation. Es ist unmöglich, solche Veränderungen einzuhalten und durchzuführen ohne den Konsens der großen gesellschaftlichen Kräfte: Arbeiter, produktive Bourgeosie, Bauern, die Massen der Jungen und der Frauen — und ohne den Konsens der großen politischen Kräfte: Kommunisten, Sozialisten, Katholiken, Laien.
Diese historische gemeinsame Verantwortung verpflichtet nicht notwendigerweise alle diese Kräfte zur gleichmäßigen Mitwirkung. Es sind von Fall zu Fall verschiedene politische Formeln möglich, verschiedene Regierungskoalitionen und Mehrheitsbildungen. Aber es bleibt diese gemeinsame Verantwortung, diese nationale Solidarität, diese Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen und zu verständigen — es bleibt vor allem die gemeinsame Pflicht, dieses Land zu verändern.
Das ist der historische Kompromiß.
Mitten in der Furt — Selbstkritik
BERLINGUER: Sie meinen offenbar die Kommunalwahlen. Am 14. Mai haben wir tatsächlich empfindliche Verluste erlitten. Es war knapp nach dem Tod von Moro, die Emotion war groß und führte zu einem Stimmenzuwachs der DC. Außerdem liegen die Gemeinden, in denen gewählt wurde, zum großen Teil im Süden, wo die Differenz zwischen allgemeinen und kommunalen Wahlen für unsere Partei immer bedeutungsvoll war. Beim Wahlgang am 25. Juni (Volksabstimmung über diverse Gesetzesvorlagen) waren die Ergebnisse schon anders. Aber ich verhehle nicht, daß die Resultate der Gemeindewahlen und Volksabstimmungen uns zum Nachdenken Anlaß geben, zur Kritik und Selbstkritik.
BERLINGUER: Weil wir vor lauter Loyalität gegenüber der Parlamentsmehrheit unsere Kritik gegenüber Regierung und DC verschwimmen ließen.
Und weil wir stillhielten und immer noch stillhalten mitten auf dem Weg zwischen Opposition und Regierung — „mitten in der Furt“, wie Sie mehrfach schon geschrieben haben.
Aber das ist nicht nur unsre Schuld. „Mitten in der Furt“ ist das ganze Land.
BERLINGUER: Die Frage unserer Regierungsbeteiligung ist immer noch offen.
Beendet ist die Notstandsphase: Entführung und Tod Moros, jene furchtbaren Tage, in denen wir, zusammen mit den Führern der Christdemokraten, Republikaner und anderer Parteien die Verantwortung übernahmen für eine feste Haltung gegenüber dem Angriff der Terroristen auf die Republik.
Dann die Volksabstimmungen, dann die Präsidentenwahl. Es waren sechs schreckliche Monate. Jetzt beginnt eine neue Phase: die Verwirklichung des gemeinsamen Regierungsprogramms.
Es gibt die Probleme des Südens, Neapel, Arbeitslosigkeit, die Jugend, die Sanierung der öffentlichen Finanzen — wir werden äußerst hart und anspruchsvoll sein in diesen Punkten. Die Regierung weiß: Wenn sie das Programm nicht innerhalb der vereinbarten Zeit und mit dem vereinbarten Inhalt durchführt, sind wir entschlossen, aus der Parlamentsmehrheit herauszugehen.
Wenn jemand denkt, daß wir in dieser Mehrheit ruhig und zufrieden drin bleiben werden, weil wir uns dadurch „legitimieren“ in dieser Gesellschaft — na, der hat die Rechnung ohne uns gemacht.
Wir sind in die Parlamentsmehrheit gegangen aus Verantwortung gegenüber dem Land und weil wir uns bewußt sind, daß unser Beitrag wichtig ist. Aber wir werden nicht drin bleiben, wenn wir sehen, daß diese Mehrheit nicht auf der Höhe der ihr gestellten Aufgabe steht und jene Pflichten nicht erfüllt, derentwegen sie gebildet wurde.
Europapartei
BERLINGUER: Stimmt. Wir wissen: Die europäische Integration wird vorwiegend betrieben — wenigstens bisher — von Kräften und Interessen, die eng verflochten sind mit jenen kapitalistischen Strukturen, die wir ändern wollen. Wir wissen auch, daß eine von solchen Kräften betriebene supranationale Integration unserer nationalen Transformation Fesseln auferlegt.
Das ist der Grund — und er ist durchaus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen —, warum die französischen Kommunisten und auch Sozialisten sich so distanziert verhalten gegenüber der Beschleunigung der EG-Integration, wirtschaftspolitisch, allgemein politisch und vor allem durch den neuen Währungsfonds.
Wir glauben aber, daß es jedenfalls nötig ist, die europäische Einheit voranzutreiben. Die Herausforderung, die darin steckt, müssen wir akzeptieren und bestehen. Wir müssen den Klassenkampf mit demokratischen und neuartigen Methoden emporheben auf die europäische Ebene.
BERLINGUER: Die Antwort lautet ja. Wir wollen im europäischen Westen eine Ordnung, ökonomisch, sozial und staatlich — die nicht mehr kapitalistisch ist. Sie soll von keinerlei Modell die Kopie sein, und keinerlei Wiederholung von bisherigen sozialistischen Erfahrungen. Und sie soll nicht beschränkt sein auf die Exhumierung von Experimenten sozialdemokratischen Typs, wo einfach der Kapitalismus verwaltet wird. Wir sind für eine dritte Lösung (zwischen bisherigem Sozialismus und Sozialdemokratie). Sie ergibt sich aus der Unmöglichkeit, sich mit dem Zustand der heutigen Welt abzufinden.
BERLINGUER: Gerade um die Demokratie zu retten, sie geräumiger zu machen, stärker, besser geordnet — gerade deshalb muß der Kapitalismus überwunden werden. Die historische Erfahrung zeigt, zumindest von den zwanziger Jahren aufwärts: Die Wiedereroberung, Erhaltung und Entwicklung der Demokratie sind Ergebnis eines Kampfes, dessen Protagonisten die Arbeiterklasse und ihre Parteien sind und in vorderster Front die Kommunisten.
Umgekehrt waren es die kapitalistischen und bürgerlichen Kräfte, die zur Bewahrung ihrer Herrschaft nicht gezögert haben, die Demokratie zu beschränken, zu amputieren, inhaltsleer zu machen oder — mittels Faschismus — überhaupt zu zerstören.
Heute zeigt sich die abgrundtiefe Krise, in der die „reifen“ kapitalistischen Staaten stecken; anarchische Auflösungsprozesse, reaktionäre Abenteurer bedrohen dort die Demokratie.
Konsequent antikapitalistisch sein heißt, konsequent demokratisch sein.
Für uns ist daher heute die Demokratie eine Eroberung der Arbeiterklasse, auf die sie nicht verzichten kann und die ihr nicht entfremdet werden darf.
Das bedeutet eine Weiterentwicklung und ein Überschreiten des Leninismus, wie er sich im Oktober 1917 und in der Folgezeit konkretisierte. Lenin faßte den Kampf für die Demokratie als Kampf auf, den die Arbeiterklasse bis zum Ende führen müsse — aber es blieb für ihn ein Kampf, der nichts weiter war als die Vollendung der bürgerlichen Revolution.
Für uns hingegen ist die Demokratie — einschließlich des Ensembles der sogenannten „formalen“ Grund- und Freiheitsrechte, ursprünglich eine Errungenschaft des Bürgertums — ein Wert universaler und permanenter Art. Das hat uns die historische Erfahrung gelehrt.
Folglich wurde für die Arbeiterklasse und die kommunistischen Parteien die Demokratie ein solcher absoluter Wert. Er muß dies auch bleiben beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft.
So jedenfalls sehen es wir italienische Kommunisten.
Und das ist für uns keine Wahrheit, die wir gerade erst entdeckt haben. Wir haben diesen Standpunkt seit Jahrzehnten. Und das sind für uns keine bloßen Worte; den Beweis lieferten viele, viele Kommunisten mit ihrem Blut — in den Gefängnissen des Faschismus, auf den Bergen in der Partisanenarmee.
Wir brauchen kein Examen in Demokratie abzulegen.
Dieses Gespräch führte Eugenio Scalfari, Herausgeber der römischen Tageszeitung La Repubblica, SP-nahe, mit dem Generalsekretär der KPI am 2. August 1978.



