Arbeit ist (nicht) genug
Im Jahr 1883, dem Todesjahr von Karl Marx, ist ein Text erschienen, der niemandem ein Jubiläum wert zu sein scheint. Seine ersten Sätze lauten:
Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht, eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende, bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht.
Statt gegen diese geistige Verirrung anzukämpfen, haben die Priester, die Ökonomen und die Moralisten die Arbeit heilig gesprochen. Blinde und beschränkte Menschen haben sie weiser sein wollen als ihr Gott; schwache und unwürdige Geschöpfe haben sie das, was ihr Gott verflucht hat, wiederum zu Ehren zu bringen gesucht. Ich, der ich weder Christ noch Ökonom, noch Moralist zu sein behaupte, ich appelliere von ihrem Spruch an den ihres Gottes, von den Vorschriften ihrer religiösen, ökonomischen oder freidenkerischen Moral an die schauerlichen Konsequenzen der Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft. [1]
Der Autor dieser Schrift: Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx und Vorkämpfer des Marxismus in der französischen Arbeiterbewegung. Der Titel der französischen Erstausgabe: Le droit a la paresse — »Das Recht auf Faulheit«; 1891 wurde von Eduard Bernstein eine deutsche Übersetzung herausgebracht.
Lohn statt Würde
Mit beißendem Spott polemisiert Lafargue gegen die Arbeitsmoral der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die man auch der Arbeiterbewgung einpflanzen wollte, gegen eine duckmäuserische Moral, die aus einer bitteren Notwendigkeit eine Tugend machte und von der »Würde der Arbeit« faselte. Es wollte ihm nicht in den Kopf, daß man in der Arbeit (in fremdbestimmter Lohnarbeit notabene) einen anderen »Sinn« sehen wollte als — gesellschaftlich — eine harte Notwendigkeit zur Reproduktion der Gattung, zur Vermittlung ihres »Stoffwechsels mit der Natur«, oder — individuell — eine Weise, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, der man, wenn man es sich irgend leisten konnte, besser aus dem Weg ging. Epikureer von geradezu klassischem Zuschnitt, haßte er die Arbeit und liebte die Muße, die Freiheit und die sinnliche Lust. Daß er gerade deshalb in hohem Maße aktiv war, steht nicht auf einem anderen, sondern auf dem gleichen Blatt. Gegen das Geschwätz vom »Sinn des Lebens«, der in der Arbeit zu suchen sei, von der »Sinnstiftung« der Arbeit, ist ihm »Sinn« überhaupt eine soziale Kategorie, die sich im Verkehr mit Menschen realisiert, nicht im Umgang mit toter Materie.
Arbeitssinn
Und wie für Lafargue, so liegt auch für Marx selbst der Sinn der Arbeit nicht vor allem in ihr selber, sondern in ihrem Ergebnis — was nicht nur heißt in ihrem intendierten Produkt, sondern, als einer gesellschaftlichen, auch in ihren geschichtlichen Folgen.
Sie werden mir entgegenhalten: Aber Marx feiert doch die Arbeit mit geradezu hymnischen Worten, lesen Sie doch die entsprechenden Passagen, etwa in den Pariser Manuskripten. Einverstanden. Doch was Marx an der Arbeit feiert, ist die durch sie vermittelte Selbsterschaffung des Menschen als Kulturwesen, das sich durch sie aus der Naturverstrickung, d.h. aber auch: aus der Notwendigkeit zur Arbeit, »herausarbeitet«. Der Begriff der Arbeit ist bei Marx dialektisch konzipiert: Ihr »Sinn« liegt in ihrer geschichtlichen Selbstaufhebung als einer »notwendigen«. Gewiß: Arbeit überhaupt, Arbeit »sans phrase« ist für Marx »ewige Naturnotwendigkeit«, unabhängig von den gesellschaftlichen Strukturen, in denen sie sich vollzieht, und den technischen Mitteln, die ihr zu Gebote stehen; geschichtlich variabel aber ist ihre Form, ihr Inhalt, und ist vor allem ihr notwendiges Gesamtquantum.
»Humanisierung der Arbeit« heißt bei Marx nicht nur — und nicht einmal in erster Linie —, sie an Ort und Stelle erträglicher machen, sondern es heißt: geschichtlich durch Arbeit von Arbeit sich befreien. Erlauben Sie mir, Ihnen jene berühmte Passage aus dem dritten Band des »Kapital« ins Gedächtnis zu rufen, die auf diese Dialektik von Freiheit und Notwendigkeit, von Arbeit und Kultur, unmittelbar Bezug nimmt:
Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Das Reich der Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung. [2]
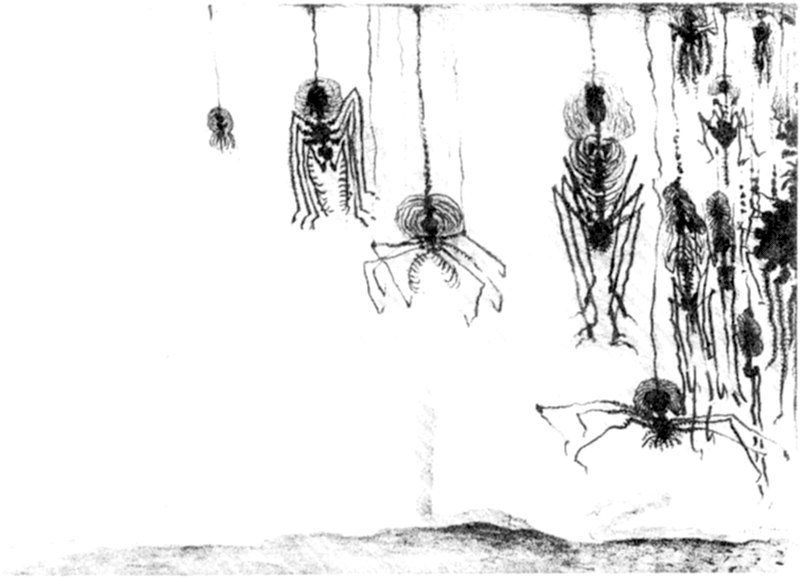
Kulturarbeit
Man wird jene »menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt« als freie kulturelle Tätigkeit bezeichnen dürfen und darunter eine geistig-körperliche Selbstentäußerung des Menschen zu verstehen haben, die, obwohl sie sich ins Soziale hinein auslegt, nicht die Form der Selbstentfremdung annimmt — »Arbeit« also in einem qualitativ veränderten Sinn. Gewiß wird man darunter nicht einfach ein »Spielen« verstehen dürfen, obwohl spielerische Momente darin enthalten sind, schon gar nicht aber die Idiotie dessen, was man heute »Hobby« nennt. An anderer Stelle nämlich polemisiert Marx gegen die, wie er sagt, »naiv-grisettenhafte Ansicht Fouriers«, freie Arbeit würde zum »Spaß« werden. »Wirklich frei Arbeiten«, sagt Marx, »z.B. Komponieren, ist grade zugleich verdammtester Ernst, intensivste Anstrengung«. [3]
Die Arbeit geht aus
Abstrakt genommen und unter Vernachlässigung aller gesellschaftlichen Formbestimmungen, wäre also die Diagnose von Hannah Arendt, daß der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe, noch das Beste, was man von dieser Gesellschaft sagen kann. Dann erschiene aber auch die Sorge um die »Kultur« in der »arbeitslosen Gesellschaft« als schlechthin paradox. Denn forçiert man nicht in nominalistischer Weise einen, wie ich sagen möchte: »ethnologischen« Kulturbegriff, der ganz einfach durch einen definitorischen Kraftakt die Gesamtheit der regelhaften Lebensäußerungen einer Gesellschaft als deren Kultur erklärt, gleichgültig welcher Art diese sein mögen, sondern sieht man sich ein wenig in der Geschichte nach dem um, was man traditionellerweise unter »Kultur« zu verstehen sich angewöhnt hat — und nur ein solcher realistischer Begriff kann kritisch mobilisiert werden —, so ist offensichtlich, daß diese »Kultur« nicht nur immer schon Besitz, sondern weitgehend auch Produkt derer war, die in einem starken Sinn frei gewesen sind von Arbeit — d.h. die Hervorbringung und die Lebensform von Schichten, die auf Grund ihrer ökonomischen und politischen Stellung jenseits des materiellen Produktionsprozesses der Gesellschaft gestanden haben und dessen Nutznießer waren, die entweder der herrschenden Klasse direkt angehörten, oder, häufiger noch, als mehr oder minder marginalisierte Individuen, von dieser ausgehalten wurden. So sehr jede ernsthafte geistige Produktion — auf dem Gebiet der Philosophie nicht weniger als auf dem der Literatur, der bildenden und darstellenden Kunst, der Musik — die schlechte gesellschaftliche Wirklichkeit transzendiert, sei es als Glücksversprechen, als Anklage, oder als stille Sehnsucht, daß es anders werde, so sehr scheint andererseits schon ihre schiere Existenz an eben diese Zustände, die sie kritisch reflektiert und überschreitet, gebunden zu sein: sozial und thematisch.
Klassenarbeit
Kultur setzt Muße voraus, Befreiung von Arbeit, historisch die Teilung der Gesellschaft in Klassen. Wenn Aristoteles schreibt: »So ist denn auch das ganze Leben zweigeteilt in Arbeit und Muße, in Krieg und Frieden, und von den Zielen des Tuns sind die einen notwendig und nützlich, die andern edel« [4] indiziert diese kategoriale Trennung des Nützlichen vom Edlen, von Arbeit und Kultur, zugleich deren ausschließliche Zuteilung auf klar umrissene Gruppen der griechischen Polis: die Ordnung der Begriffe hat ihr Korrelat in der Ordnung des Sozialen, die ontologische Differenz der Wesenheiten des »Wahren, Guten und Schönen« vom Notwendigen und Zweckmäßigen, des Ideellen vom Materiellen, hat ihre ontische Entsprechung in der Klassenstruktur der Gesellschaft. Die antike Theorie meint mit der Höherwertigkeit des Geistigen immer auch politische Herrschaft und Freiheit von körperlicher Mühsal. Als die »sklavischsten« galten Aristoteles jene Tätigkeiten, »bei denen der Körper die meiste Arbeit zu verrichten hat«. [5] Sie blieben jenen Ständen aufgelastet, die, weil sie ihn ermöglichten, aus dem Arkanbereich der Kultur ausgeschlossen waren. — Die Möglichkeit einer Änderung dieses Zustandes, einer Aufhebung der Klassenspaltung, hat Aristoteles mehr als 2000 Jahre vor Marx allein in der damals allerdings noch vollkommen fiktiven Vollautomation der Produktion gesehen:
Wenn jedes Werkzeug auf Geheiß oder auch vorausahnend das ihm zukommende Werk verrichten könnte, wie des Dädalus Kunstwerke sich von selbst bewegten, oder die Dreifüße des Hephaistos aus eigenem Antrieb an die heilige Arbeit gingen, wenn so die Webeschiffe von selbst webten, so bedürfte es weder für den Werkmeister der Gehilfen, noch für die Herren der Sklaven. [6]
Klassenkultur
Trotz enormer Fortschritte der Technologie, die dem von Aristoteles erträumten Niveau nahe gekommen zu sein scheint, hat sich an der Tatsache einer Klassenkultur bis heute wenig geändert — wohl aber hat deren Selbstverständnis fast in ihr Gegenteil sich verkehrt: »Es ist die große Lüge der bürgerlichen Kultur, sich ihres sinnstiftenden und pädagogischen Monopols dadurch zu versichern, daß sie sich zum Paradigma einer sublimierten Humanität erklärt«. [7] Denn obwohl auch sie auf Ausbeutung beruht, ihr Humanismus ein halbierter ist, setzt sie sich selbst als universale ein, die mit ihrer eigenen Partikularität auch die Zerrissenheit der Gesellschaft leugnet: sie ist »der Deckel auf dem Müll« (Adorno).
In der bürgerlichen Gesellschaft, die über die Freiheit des Marktes sich definiert, sollten alle Individuen, unbeschadet ihrer Stellung im Produktionsprozeß, am kulturellen Leben teilnehmen können. Die abstrakten Ideale der Gleichheit und Freiheit, in deren Namen die liberalistische Bourgeoisie die überkommenen ständischen Vorrechte im Bereich der Ökonomie und der Politik aufsprengte, sollten auch den Zugang zu den ideellen Reichen öffnen.
Aber wie die abstrakte Vergesellschaftung über den Markt konkret bedeutet, daß die Individuen als Käufer und Verkäufer von Arbeitskraft einander höchst ungleich gegenüberstehen und das Eigentum an Kapital über ihre gesellschaftliche Stellung und ihren sozialen Rang entscheidet, so sollte der individuelle Besitz an »Bildung«, seinerseits ökonomisch vermittelt, das Maß für die Kultiviertheit der Person abgeben; und wie die Tauschwertlogik die Produkte lebendiger Arbeit zu einem preishierarchisierten Warenuniversum verdinglicht, so gerinnt in der kulturellen Praxis der bürgerlichen Welt das Werk zu einem »Kulturgut«, das als »Erbe« verwaltet wird. Die Teilhabe an diesem — wie man in Anlehnung an die Marxsche Definition der Ware sagen könnte — »sinnlich-übersinnlichen« Wesen der Kultur bleibe zwar den meisten mangels Zeit und Bildung verschlossen, ihre Idee jedoch sei für alle verbindlich. Indem sie trotz ihres Anspruchs auf allgemeine Gültigkeit als eigene Sphäre über die materiellen Lebensvorgänge sich erhebt, läßt sie deren Organisation als ein Minderes unter sich.
Die insbesondere im Deutschen übliche schroffe Entgegensetzung von »Kultur« und »Zivilisation«, und die deutliche Rangordnung der beiden Begriffe, drückt diesen Sachverhalt sprachlich aus. Die so abgehobene Kultur hat Herbert Marcuse als »affirmativ« bezeichnet: »Unter affirmativer Kultur sei jene der bürgerlichen Epoche des Abendlandes angehörige Kultur verstanden, welche im Lauf ihrer eigenen Entwicklung dazu geführt hat, die geistig-seelische Welt als ein selbständiges Wertreich von der Zivilisation abzulösen und über sie zu erhöhen.« [8]
Diese Kultur leistet als ganze das, was Hegel von der Philosophie gefordert hat: mit der Wirklichkeit zu versöhnen. Da sie die Versöhnung jedoch nur ideell leistet, die materielle soziale Wirklichkeit unangetastet läßt, mündet sie in einen Kultus schöner Innerlichkeiten und edler Haltung. Vermittelt wird diese Pose der Kultiviertheit von den aparten Einrichtungen des sogenannten Bildungssystems, die dem nach Höherem strebenden Adepten eine durchaus entmündigende Ehrfurcht vor dem seiner kritischen Potenz beraubten »kulturellen Erbe« ansozialisiert. Mit Recht hat sie daher Nicos Poulantzas grosso modo den »ideologischen Staatsapparaten« zugeordnet. In ihren heutigen Spätformen kommt affirmative Kultur herab zu dem, was Hegel noch ein Greuel war: zur »Erbauung« und zur feierlichen Ergänzung des miesen Alltags: in Wörtern wie »Kulturwochen« findet dieser Sachverhalt seinen ungewollt ironischen Ausdruck.
Aber wie jeder Idealismus ist auch die idealistische Kultur ambivalent. Ihr allgemein humanistischer Anspruch, die Gesamtheit der menschlichen Wirklichkeit zu durchdringen und nach ihren Werten zu gestalten, und ihr praktischer Rückzug auf eine Welt des schönen Scheins, dessen Rezeption zum passiven Genuß und zur Freizeitgestaltung degeneriert, setzt Widersprüche frei, an denen sie sich wundreibt. Die klassische Welt hatte noch offen und ohne zu lügen ausgesprochen, was es mit der Kultur auf sich hat: daß sie nur für die Wenigen da ist, für die, die Zeit haben und daß die, die arbeiten müssen, um jene zu ernähren, von ihr ausgeschlossen sind. Das Wort »Kulturträger« hätte damals noch einen anderen Sinn und einen nichtideologischen Klang gehabt.
Lügenkultur
Der modernen Welt ist diese grobe Ehrlichkeit abhanden gekommen. Da die »bürgerliche Basisideologie vom gerechten Tausch« (Habermas), der die Zirkulation der Güter und die Vergesellschaftung der Individuen über den Markt zwanglos regeln soll, durch die Abpressung von Mehrwert in der Produktion systematisch desavouiert wird, schlägt die kapitalistische Produktionsweise permanent mit so etwas wie einem »Legitimationsproblem« sich herum. Faßt man »Ideologie« nicht nur — in Marxscher Tradition — als notwendig falsches Bewußtsein auf, sondern auch funktional als säkularisierte Sinngebung von Versagung, so kann man sagen, daß die bürgerliche Gesellschaft die historisch erste Formation ist, welche »Ideologien« im prägnanten Sinn hervorgebracht hat; das schlechte Gewissen ist für sie konstitutiv. Kultur, die sich als ideologischer Überbau über die schlechte Wirklichkeit erhebt und deren »allgemeinen Trost- und Rechtfertigungsgrund« abgibt, hält so, als Ideologie, zugleich auch die Erinnerung daran wach, daß es anders sein könnte. Lassen sie mich noch einmal Herbert Marcuse zitieren:
Indem die große bürgerliche Kunst das Leid und die Trauer als ewige Weltkräfte gestaltet hat, hat sie die leichtfertige Resignation des Alltags immer wieder im Herzen der Menschen und Dinge ein überirdisches Glück in den leuchtenden Farben dieser Welt gemalt hat, hat sie neben dem schlechten Trost und der falschen Weihe auch die wirkliche Sehnsucht in den Grund des bürgerlichen Lebens eingesenkt ... So hat die Kunst den Glauben genährt, daß die ganze bisherige Geschichte zu dem kommenden Dasein nur die dunkle und tragische Vorgeschichte ist. [9]
Das Glück, das die Kunst verspricht, ist gebrochen durch das Wissen, daß sie selbst sich noch dem gesellschaftlichen Unglück verdankt, über das sie hinaus möchte. Dieser Widerspruch durchfurcht alle ihre großen Werke und macht deren tragischen Charakter aus.
Notkunst
Mit einer sehr produktiven philologischen Fehlleistung schreibt Theodor Adorno in seiner ästhetischen Theorie Hegel den Satz zu: »Kunst ist das Bewußtseyn von Nöthen«. Er knüpft daran seine bekannten Spekulationen über die Möglichkeit des Absterbens der Kunst in einer geschichtlich zur Ruhe gekommenen, versöhnten Gesellschaft. Analog zum Marxschen Gedanken von der Abschaffung der Philosophie durch deren Verwirklichung sollte nach Hegel die Kunst aufgehoben werden dadurch, daß sie in das soziale Leben übertritt und in ihm sich verliert. Als eigenständige, nichtbegriffliche Ausdrucksmanifestation des »Bewußtseyns von Nöthen« aber würde sie in einer befreiten und versöhnten Gesellschaft mit diesen »Nöthen« verschwinden. [10]
Man wird hier entgegenhalten, daß es nicht nur gesellschaftlich bedingtes Leiden sei, das den Antrieb kulturellen Schaffens darstellt, sondern daß es einen naturhaften Bodensatz des Sozialen gebe, naturale Elemente einer Condition Humaine, die geschichtlich nicht überholbar sind, und daß vor allem sie es sind, die die großen Themen der Kunst, der Religion und im übrigen auch einer gewissen Sorte von Philosophie abgeben, und nicht die Teilung der Gesellschaft in Klassen unmittelbar: Alter, Krankheit und Tod sind die Perspektive eines jeden Menschen, egal, welcher Tradition, welchem Geschlecht, welcher Klasse oder welchem Stand er angehört. Die Menschen sind sterblich wie alle Tiere; aber sie wissen darum. Und vielleicht steht tatsächlich der Schock auf diesen metaphysischen Skandal am Anfang jeder Kultur, vielleicht ist diese, von ihrer abstraktesten Seite genommen, immer auch der Versuch, mit der fundamentalen, transsozialen und daher geschichtlich unaufhebbaren Absurdität der menschlichen Existenz fertig werden und ihr so etwas wie einen »Sinn« abzupressen — und sei es nur, indem man die Absurdität zum Ausdruck bringt und so sich reflexiv von ihr distanziert. Ich sage: zu Anfang und von der abstraktesten Seite genommen. Denn was bedeutet schon die kahle Tatsache, daß der Mensch als Naturwesen Begierden hat und sterblich ist, gegenüber den Formen, in denen er seine Begierden realisiert, in denen sein Tod sich vollzieht, oder vollzogen wird, und sein Leben dahin. »Hunger ist Hunger«, sagt Marx in der »Kritik der politischen Okonomie«, »aber Hunger, der sich durch gekochtes, mit Gabel und Messer gegessenes Fleisch befriedigt, ist ein anderer Hunger, als der rohes Fleisch mit Hilfe von Hand, Nagel und Zahn verschlingt«. [11] Und wie mit dem Hunger, so verhält es sich mit jedem menschlichen Bedürfnis, mit jeder menschlichen Lebensäußerung, so naturhaft deren Antrieb oder deren Notwendigkeit auch sein mag: sie sind allemal gesellschaftlich formbestimmt, kulturell determiniert. »Natürlichkeit«, die man zu allen Zeiten den unteren Schichten als gesunde Lebensweise empfohlen hat, ist selbst eine kulturelle Norm; sie ist das Pathos des Schlichten, die Ideologie des Glücks der Armut angesichts des historisch möglichen, aber gesellschaftlich verwehrten Reichtums. Nichts am Menschen ist Natur unmittelbar, weder sein Glück noch sein Schmerz, nicht einmal sein Tod: sie sind in ihrer Bedeutung und in ihrer konkreten Qualität gesellschaftlich vermittelt. Und wenn heute eine auf akademischem Boden wieder in Mode kommende Existentialontologie das »eigentliche« Leben als ein Vorlaufen zum Tode bestimmt, der »entschlossen« auf sich zu nehmen sei, so unterschiebt sie das Allerabstrakteste als das Konkrete. Eine Philosophie, der es wirklich um die menschliche Existenz zu tun ist, redet nicht von ihr, sondern von ihren Bedingungen. Am trüben Tiefsinn der Frage, mit der Heidegger einen seiner ruralen Texte eröffnet: »Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?« [12] zeigt sie sich desinteressiert. Statt dessen kreist sie unentwegt um die Frage: »Warum ist Seiendes so, wie es ist, und nicht vielmehr besser?«
Schlafkultur
Dafür, daß es tatsächlich durch alle Brüche und Katastrophen hindurch, besser wird, daß es einen realen Fortschritt in der Geschichte geben kann, dafür hat die bisher einzige progressive Kraft der neuesten Geschichte, die Arbeiterbewegung und die materialistische Theorie, die Voraussetzung nicht in einer Aneignung und Verbreitung der kulturellen Traditionen unmittelbar gesehen, sondern in der technisch-industriellen Entwicklung als der zwar ihrerseits immer noch abstrakten, aber notwendigen Bedingung von Humanität. Den Konformismus der sozialdemokratischen Führer jedoch, die freilich in der Verbreitung des sogenannten »kulturellen Erbes« ihr Ideal erblicken, hat seinerzeit schon Karl Kraus sarkastisch kommentiert: Es sei, als wolle man seine Anhänger auf jene Theaterplätze setzen, die von der Bourgeoisie schon aus Langeweile verlassen worden sind. Und Bert Brecht hat bekanntlich auf die Bemerkung Reichenbachs, die Frage, wie bürgerliche Kultur in den Sozialismus hinübergerettet werden könne, bereite ihm schlaflose Nächte, geantwortet: ihn, Brecht, schläfere diese Frage ein ...
Kulturtraum
Denn wovon Kultur nur träumte und was sie trügerisch versprach, das leistete Technologie real: sie griff ein in die materiellen Lebensbedingungen der Menschen und veränderte sie, brachte verknöcherte Herr/KnechtVerhältnisse zur Auflösung. Trotz des massenhaften Elends, das die Industrialisierung in ihrer Frühphase mit sich gebracht hat, verband sich mit dem technisch-industriellen Fortschritt die Hoffnung, daß die Erhöhung der Arbeitsproduktivität in letztlich allen Bereichen gesellschaftlich notwendiger Arbeit deren Gesamtquantum auf ein in der Geschichte nie dagewesenes Minimum zu reduzieren und auf die Individuen gleichmäßig zu verteilen ermöglichen werde, bei gleichzeitig hohem Niveau individueller und sozialer Bedürfnisbefriedigung. Kurz: daß der technische Fortschritt das Potential für Freiheit in Reichtum schaffen werde. Ein produktives Potential, das allerdings in historische Aktualität nur umschlagen könne durch eine ihm entsprechende, nicht minder fundamentale Transformation der Produktionsverhältnisse in eine von Ausbeutung befreite sozialistische, letztlich kommunistische Gesellschaft. Aber auch dafür, daß dieser revolutionäre Bruch mit der kapitalistischen Produktionsweise tatsächlich eintreten werde, auch dafür sah die materialistische Geschichtsphilosophie in der kapitalistischen Entwicklung der Produktivkräfte selbst die Garantie.
Um diese Hoffnung ist es heute deutlich stiller geworden — und zwar scheinbar paradoxerweise ausgerechnet in dem historischen Moment, als, zumindest in den hochindustrialisierten Ländern, durch den Stand der Technologie eine drastische Reduktion der gesamtgesellschaftlichen
Maszarbeit
Arbeitszeit nicht nur möglich, sondern notwendig geworden ist — aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Gründen. Gerade die kapitalistische Formbestimmung selbst, der dieser Prozeß der Reduktion ökonomisch vermessener Arbeitszeit unterliegt, läßt die objektive Klugheit marxistischer Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen mit ihrer flotten Choreographie der Befreiung — die übrigens so schön bei Marx sich gar nicht findet — unglaubwürdig erscheinen und manchmal dumpfe Utopien der »Selbstverwirklichung« in überholt geglaubten handwerklich-agrarischen Produktionsformen bei den Opfern des Fortschritts auf Resonanz stoßen. Denn gerade die sogenannte »Entfesselung der Produktivkräfte«, auf die der klassische Marxismus (und im übrigen auch noch Sohn-Rethel) seine revolutionstheoretischen Kalküle aufgebaut hat, scheint diese Kalküle durchzustreichen — wenn es denn »Produktivkräfte« sind, was da heute »entfesselt« wird. Autoren, die gestern noch die »Aktualität der Revolution« verkündet haben, nehmen heute indigniert »Abschied vom Proletariat«.
The American Way
Tatsächlich muß jede revolutionäre Perspektive in den hochindustrialisierten Ländern heute naiv erscheinen — zumindest eine nach dem klassischen Schema, das dem Kapital so etwas wie eine Organisationsleistung für seine eigene Abschaffung zugetraut hat. Worauf die kapitalistische Produktionsweise, hat sie sich in einer Gesellschaftsformation einmal voll durchgesetzt, historisch hinauszulaufen scheint, ist nicht ihre eigene Aufhebung, sondern umgekehrt gerade die Zerstörung der Kräfte, die, von ihr selbst hervorgebracht, ihre Aufhebung hätten leisten sollen. Schon vor Jahren hat Oskar Negt darauf hingewiesen, daß in keiner Gesellschaftsformation, in der das kapitalistische Wertgesetz sich voll entfaltet hat, eine sozialistische Revolution gelungen ist; ganz bestimmte Ungleichzeitigkeiten der Produktionsweisen innerhalb der betreffenden Formation scheinen dafür die Voraussetzung zu sein. Sind diese eingeebnet, so ist es mit der historischen Chance vorbei — es sei denn, es entstehen neue. Oder wie Deleuze und Guattari formuliert haben: »Der Kapitalismus hat mit seinem Selbstzweifel gebrochen, wohingegen selbst die Sozialisten nicht davon ablassen wollten, an die Möglichkeit eines natürlichen Todes durch Verschleiß zu glauben. Noch nie ist jemand an Widersprüchen gestorben. Und je mehr alles aus dem Leim geht, umso besser läuft es — auf amerikanische Art und Weise«. [13]

± Arbeitszeit
Man sagt oft, und auch ich habe es gerade gesagt, durch die Entwicklung der Maschinerie werde die für ein bestimmtes konsumtives Reproduktionsniveau »notwendige gesamtgesellschaftliche Arbeitszeit« reduziert — mag sein. Doch sollte man nicht vergessen, daß mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise, die diesen Fortschritt der Technologie strukturell erzwungen hat, zunächst eine enorme Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Arbeitszeit verbunden war, der gegenüber die heute zur Diskussion stehende Reduktion der Wochenarbeitszeit von fünf oder vielleicht zehn Stunden sich ausgesprochen bescheiden, um nicht zu sagen: marginal ausnimmt. Die gesamte Geschichte der Arbeiterbewegung ist ja, seit ihrem Kampf um die 10-Stunden-Bill, vor allem auch ein Kampf um die Reduktion der Arbeitszeit gewesen, was zunächst nicht mehr bedeutete, als eine schrittweise Zurücknahme ihrer vorangegangenen Erhöhung. Sieht man sich die Schätzungen von Sozialhistorikern über die Arbeitszeiten im europäischen Hochmittelalter an, so erscheint es ausgesprochen lächerlich, um nicht zu sagen: zynisch, wenn diejenigen, die von der eigentlich reproduktiven Arbeit ohnehin befreit sind, sich in väterlicher Weise um die »Freizeitprobleme« derer Sorgen machen, die nun nicht mehr 40 oder 50, sondern vielleicht bald nur mehr 35 oder 30 Stunden in der Woche ausgepowert werden sollen.
Reparaturarbeit
Nicht, wie Hannah Arendt geschrieben hat, daß der »Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht«, ist das Problem, sondern daß das kapitalistische Organisationsprinzip der Gesellschaft über den Arbeitskräftemarkt zerfällt, ohne daß in ihrem Schoße eine höhere Form der Vergesellschaftung herangereift wäre. Man muß sich klar sein, was man unter »notwendiger Arbeit« verstehen will. In einem gebrauchswerttheoretischen Sinn wäre heute vermutlich mehr notwendige Arbeit zu leisten als je zuvor. Die unter dem kategorischen Akkumulationsgebot der Verwertungslogik in ganz bestimmte Richtungen treibhausmäßig entwickelte Maschinerie hat diese Arbeit nicht verringert, im Gegenteil, sie hat sie vermehrt: schon durch die ökologischen Zerstörungen, die sie angerichtet hat, würde sie jede vernünftige Gesellschaft zu einer Art »negativer Arbeit« verpflichten: zur Reparaturarbeit an ihrer eigenen Geschichte. Die eigentliche Reproduktionsarbeit, welche die notwendige Basis jeder Gesellschaft darstellt, die jedoch, weil sie nicht tauschwertbildend ist, ökonomisch gar nicht erst thematisiert wird — wie der ganze Bereich der Beziehungsarbeit zwischen Menschen, den Geschlechtern und Generationen, die weitgehend den Frauen aufgelastet bleibt, die Arbeit also im materiellen und seelischen »Haushalt« der Gesellschaft —, diese Arbeit wurde durch die kapitalistische Modernisierung weder weniger noch leichter, im Gegenteil, sie wurde erschwert und ausgeweitet: allein durch die zunehmend notwendig werdende psychische Reparaturarbeit an den Menschen selber.
Zerstörungsleistung
Werttheoretisch gesehen ist allerdings eher die Arbeit im Rahmen des Reaganschen Rüstungsprogramms notwendige Arbeit als die Erziehung von Kindern: denn an ihr hängt, über eine lange Kette von Investitionsanreizen, noch die Versorgung mit den elementarsten Konsumgütern. Produktive Arbeit unter diesem Gesichtspunkt ist mehrwert- und kapitalproduzierende Arbeit, und nichts sonst; auf den Gebrauchswert der hergestellten Machwerke kommt es dabei nicht im geringsten an; sie müssen zirkulieren, das ist alles. Diese Logik ist irrwitzig, aber sie ist realitätsmächtig.
Daß die Zirkulation von Menschen und Waren als gesamtgesellschaftliches Integrationsprinzip zerfällt, daß die abstrakte, wertbildende Arbeit ausgeht, ohne daß sie als konkrete, gebrauchswertbildende Arbeit gesellschaftlich neu definiert und organisiert werden könnte — das ist das Problem, und nicht, daß die Arbeit schlechthin ausgeht.
Was Marx seinerzeit schon von der Aktiengesellschaft gesagt hat — daß sie die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise im Rahmen und in Form der kapitalistischen Produktionsweise sei — gilt heute tendenziell für alle Momente des gesellschaftlichen Lebenszusammenhanges; es gilt insbesondere für die Form, welche die Arbeitsfreiheit »Befreiung von Arbeit« unter hochindustrialisierten Bedingungen in Gesellschaften annimmt, deren synthetisches Prinzip die kapitalistisch organisierte Warenproduktion ist und bleibt: als Arbeitslosigkeit ist sie die Travestie auf alles, was darunter einmal verstanden wurde. Die heute schon klassische Studie von Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld aus den früheren dreißiger Jahren: Die Arbeitslosen von Marienthal zeigt, was lang andauernde Arbeitslosigkeit über das unmittelbare materielie Elend hinaus für die Betroffenen bedeutet: psychische Desintegration und Verfall der sozialen Identität, Zerfall der Zeitstruktur bis in die biologischen Rhythmen hinein, Niedergang der Wunschproduktion selber, Verzweiflung als Vorstufe zur Lethargie. Selbst wenn es heute gelingen sollte, durch drastische Reduktion der normierten individuellen Arbeitszeit (besser sollte man von der Reduktion der Verwertungszeit der Arbeitskraft reden) die »Arbeit« (besser: die dem Verwertungsprozeß unterworfene Arbeitszeit) gleichmäßiger unter die Individuen zu verteilen, ist mit einer weiteren Zunahme der Arbeitslosen, als der Zahl derer zu rechnen, die aus dem Verwertungsprozeß ausgegrenzt sind; und selbst wenn es darüber hinaus gelingen sollte, durch den Aufbau entsprechender Sozialfonds — deren Finanzierung durch eine sogenannte »Maschinenabgabe« für Rationalisierungsinvestitionen ja schon vorgeschlagen wurde — Massenelend wie in den dreißiger Jahren zu vermeiden, bleiben sie von einer Einflußnahme auf die zentralen Funktionsmechanismen der Gesellschaft ausgeschlossen; da sie nicht einmal ihre Arbeitskraft entziehen können, bleibt ihnen selbst eine negative Sanktionsgewalt gegenüber der Produktionslogik versagt. Umgekehrt aber bleiben sie abhängig von der Versorgung durch den »produktivistischen Leistungskern« (J. Hirsch) der Gesellschaft, inkorporiert in einer weitgehend automatisierten Industrie. Denkt man die Kapitallogik linear zu Ende, so würde es sich bei diesen funktionslos gewordenen Individuen aus der Sicht der Herrschenden um eine riesige Masse von Menschen handeln, die man durchzufüttern und mit vorfabriziertem »Sinn« zu versorgen hätte, um sie bei der Stange zu halten — in panem et circenses hätte das ja sein antikes Vorbild, und im Medienverbund seine moderne Realisierungschance.
Wachstumsbranchen
Was dabei passiert, hat Marx andeutungsweise schon mit dem Begriff der »sekundären Ausbeutung« beschrieben, nämlich eine Ausbeutung in der sogenannten »Konsumsphäre«. Dabei handelt es sich nicht vor allem um eine ökonomische Ausbeutung unmittelbar, obwohl auch diese eine bedeutende Rolle spielt — denken Sie nur an die künstliche Entwertung von Gebrauchsgütern durch technische und modische Obsoleszenz. Das historisch Neue aber ist, daß durch den Komplex der Kulturindustrie die Ausbeutung sich auf das Bewußtsein selbst bezieht. Die massenmedial produzierten und distribuierten Traumklischees und Identifikationsfolien sind ja nicht aus dem Nichts fabriziert, sondern sie sind die Verarbeitungsprodukte eines naturwüchsigen Rohmaterials von Wünschen, Hoffnungen und Vorstellungen der Individuen, die an diese als Fertigwaren wiederum zurückgeliefert werden.
Die ideologischen Mittel zur Produktion von Herrschaft sind gemacht aus dem Material der Träume von Freiheit der Beherrschten selber. Durch diese Dialektik werden sie zu Betriebsmitteln für die Reproduktion der Produktionsverhältnisse. Als solche verschleißen sie, und müssen nachgeliefert werden. Und in dem Maße, als die ökonomische Integration über den Arbeitsmarkt immer brüchiger und fadenscheiniger wird, wächst der Bedarf an Ideologien, beschleunigt sich ihr Umschlag, verkürzt sich ihr Konjunkturzyklus. Damit nimmt die Ausbeutung der Phantasieproduktion der Menschen zu, und wir nähern uns einer Situation, von der Alexander Kluge gesagt hat, daß die kollektiven Lebensprogramme der Menschen schneller zerfallen, als die Menschen individuell Lebensprogramme nachliefern können.
Nicht also, daß der » Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht« — das tut sie gar nicht — ist oder wäre das Problem, sondern daß mit dem Verlust der Lohnarbeit ein Verlust aller gesellschaftlichen Funktionen verbunden ist. Da allein die auf den Verwertungsprozeß bezogene Arbeit gesellschaftlich organisiert ist, bedeutet eine Aufhebung dieser Arbeit zugleich eine Zerstörung von Gesellschaftlichkeit selber. Das Individuum fällt in eine schlechte Privatheit zurück, die in keinem dialektischen Verhältnis zur Öffentlichkeit mehr steht, sondern ihr konsumtiv subsumiert ist. Es wird zum »Idioten« im etymologisch strengen: Sinn: zu jemand, »der kein Amt hat«.
Eule der Minerva
oder Käuzchen der Psichore
Unter diesen Umständen hat man im Entstehen und in der Ausweitung mehr oder minder selbstversorgender, vom »produktivistischen Leistungskern« der Großindustrie möglichst abgekoppelter »Alternativökonomien«, verbunden mit »alternativen Lebensweisen«, eine historische Chance sehen wollen, das kapitalistische Industriesystem gewissermaßen zu unterlaufen. Diese Überlegungen scheinen mir recht fragwürdig zu sein — und zwar als abgehobene Überlegungen, die als solche leicht auf eine positive Theorie der Apartheit hinauslaufen könnten.
Wenn ich das sage, so geht es mir nicht darum, denjenigen, die diese Lebensform zu ihrer eigenen Praxis gemacht haben — sei es aus subjektivem Abscheu vor der Integration, sei es aus objektiv erlittener Desintegration —, Lehren zu erteilen; das erschiene mir aus dem Munde von jemand, der sich selbst einigermaßen arrangiert hat und in einer relativ gesicherten Position lebt, nicht nur obszön, sondern auch sinnlos.
Es geht mir vielmehr ganz im Gegenteil darum, theoretische Versuche zurückzuweisen, das, was realiter eine Verarbeitungsform des Mangels, eine Summe von Überlebensstrategien darstellt, soziologisch einzufangen und vor einen geschichtsphilosophischen Karren zu spannen. So haben z.B. Autoren wie André Gorz, in einer Art Überanpassung an den Wettlauf, in der »Nicht-Klasse« der »Nicht-Arbeiter« das neue historische Subjekt einer sozialistischen Transformation und im Entstehen einer »dualen Wirtschaft« deren organisatorische Form zu bestimmen versucht. Scheinbar das absolute Gegenteil dessen, was Gorz in den sechziger Jahren vertreten hat, ist es in Wahrheit der gleiche Ouvrierismus in anderer Gestalt. Denn indem das »eigentliche Leben« in einem kleinräumig organisierten informellen Sektor der Subsidiärproduktion sich abspielen, die individuelle Existenz in ihm ihren beschränkten Sinn und Inhalt finden soll, bleiben deren allgemeine Rahmen- und Ordnungsprinzipien — Staat, Recht und die »formelle« Ökonomie der Großindustrie — von einer substanziellen Demokratisierung ausgeschlossen. Die Selbstbescheidung der politischen Vernunft auf eine regionale »Lebenswelt« nicht entfremdeter Arbeit überläßt die allgemeine Unvernunft ihrem blinden Schicksal. Denn es ist klar, daß die beiden Sphären einer dualen Wirtschaft und Gesellschaft nicht in einer gleichrangigen und friedlichen Beziehung zueinander stehen können, sondern allein in einem Herrschafts- und Unterordnungsverhältnis.
Das Glück im alternativen Winkel ist die unmögliche Utopie eines postindustriellen Biedermeier. — Vielleicht hat der junge Marx eine ideologisch ähnliche Situation im Blick gehabt, als er in den Vorarbeiten zu seiner Dissertation schrieb: »... wenn die allgemeine Sonne untergegangen ist, (leuchtet) das Lampenlicht des Privaten (auf)«. [14]
Realkultur
War also die Behauptung, mit der ich begonnen habe: »Kultur setzt Muße voraus, Befreiung von Arbeit« — falsch? Genauer gesagt: Wird sie falsch, wenn man sie nicht mehr nur auf eine Klasse bezieht, sondern sie gesellschaftlich verallgemeinert, was unsere Konservativen immer behaupten? Nein, sie bleibt auch dann richtig. Aber sie nennt nur die allerabstrakteste Bedingung. Worin immer Kultur im einzelnen bestehen mag — die Teilhabe an ihr verlangt, daß man sich um die öffentlichen Angelegenheiten kümmert, und daß diese Teilhabe an der politischen Öffentlichkeit auch reale Konsequenzen hat.
Kulturelle Praxis ist gesellschaftlich allgemeine Praxis, selbst dann, wenn ihre Ausübung einer bestimmten Klasse vorbehalten bleibt; sie ist daher eo ipso immer politisch, genauer: sie ist jenes Moment von Politik, mit dem diese über sich selbst hinausschießt. Kultur verlangt nach Muße, aber sie ist nicht Muße. Die klassische Kultur war ja nicht nur die Kultur derjenigen, die von der Arbeit befreit waren, sondern die zugleich die Arbeit politisch organisierten und die öffentlichen Angelegenheiten des Gemeinwesens regelten. Umgekehrt blieben diejenigen, die zur Arbeit verdammt waren, vom politischen Leben ausgeschlossen und daher von Kultur.
Die materiellen Bedingungen dafür, diese Schranken niederzureißen, sind heute vorhanden, und das Verlangen danach ist es auch — wenn auch oft ausgedrückt in schwer verständlicher Form. Denn in dem, was man heute wieder ohne zu erröten die »Frage nach dem Sinn des Lebens« nennt, der sogenannten Sinnfrage, deren epidemische Verbreitung man gemeinhin dem Verlust an Arbeit zuschreibt — so nach dem alten Motto: »Wer nicht arbeitet, kommt auf schlechte Gedanken« —, drückt in Wahrheit eine Begierde nach Gesellschaftlichkeit sich aus, keinen Mangel an Metaphysik, mit der man die »Sinnlücke« zu stopfen sich bemüht, weil die Arbeitsplätze rar geworden sind. Damit die Leute in ihrer freien Zeit nicht auf schlechte Gedanken kommen, d.h. sich assoziieren und politisch zu handeln beginnen, werden sie von oben her mit Lebenssinn versorgt. Kein Anspruchsniveau wird dabei vergessen: von der Revitalisierung des nationalen Kulturerbes über eine zweite Christianisierungswelle Europas bis zu den Importen von Billigsinn aus Ostasien reicht das Angebot an metaphysischen Ersatzstoffen für Geselligkeit. Doch zeigt allein die Intensität der Versorgung, daß die ideologische Lage prekär geworden ist.
Eine Kulturpolitik, die es anders möchte, schwimmt da unmittelbar gegen den Strom. Aber vielleicht liegt gerade in dem massenhaften »Sinnbedürfnis« künstlich isoliert gehaltener Individuen eine Chance, durch dessen Enttäuschung den Menschen ein Stück Autonomie zurückzugewinnen, die nur in solidarischem Handeln Wirklichkeit werden kann. Die Arbeit daran wäre selbst Kultur, eine Arbeit, die sogar einen Sinn hätte.
R. B., Mitglied unseres Beirates, sprach dies in Recklinghausen am 17. Juni, Arbeitstagung d. Kulturpol. Ges. e. V. »Zukunft der Arbeit — Zukunft der Kultur«. Geplant ist ferner der Abdruck dieses Beitrages in: »Kulturzerstörung« Römerberggespräche Athenäum Verlag 1983.
[1] P. Lafargue, Das Recht auf Faulheit, Frankfurt (EVA) 1966, S. 19
[2] K. Marx, Das Kapital Bd. III, MEW 25, S. 828
[3] K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Frankfurt/Wien (EVA/Europa) o.J., S. 505
[4] Aristoteles, Politik 1333 a, Z. 30f
[5] Aristoteles, Politik 1258 b, Z. 35f
[6] zit. nach: K. Marx, Das Kapital Bd. I., MEW 23, S. 430
[7] L. Baier, Französische Zustände, Frankfurt (EVA) 1982, S. 222
[8] H. Marcuse, Über den affirmativen Charakter der Kultur, in: Zeitschrift für Sozialforschung Jg. VI/1937, S. 60 (dtv reprint, München 1980)
[9] H. Marcuse, a.a.O., S. 63
[10] Siehe dazu kritisch: J. Trabant, »Bewußtseyn von Nöthen«. Philologische Notiz zum Fortleben der Kunst in Adornos ästhetischer Theorie, in: Text + Kritik: Th. W. Adorno, München 1977
[11] K. Marx, Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie, MEW 13, S. 624
[12] M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübinger (Niemeyer) 1976, S. 1
[13] G. Deleuze, F. Guattari, Anti-Ödipus, Frankfurt (Suhrkamp) 1974, S. 193
[14] K. Marx, Hefte zur epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie, MEW Erg. Bd. 1, S. 218


